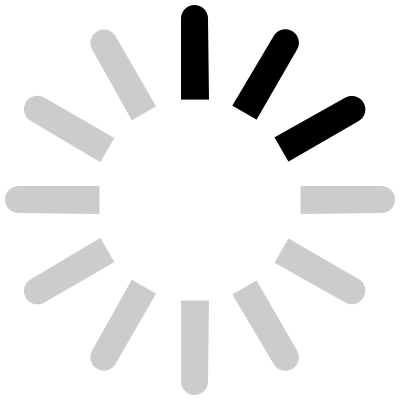06102 Krankenhaus 4.0 – Status quo und Perspektiven
|
In Anlehnung an den Begriff der Industrie 4.0 ist mittlerweile auch der Begriff Krankenhaus 4.0 in aller Munde. Verbunden damit sind Hoffnungen, durch moderne Technologien Mittel und Wege zu finden, um den permanent unter Kostendruck ächzenden Krankenhausmarkt effizienter und effektiver zu gestalten. Der vorliegende Beitrag will aufzeigen, wie der Status quo eines Krankenhauses 4.0 tatsächlich ist, was Fiktion oder tatsächlich machbar scheint und weshalb das Krankenhaus 4.0 über rein technische Fragestellungen deutlich hinausgeht. von: |
1 Ausgangssituation: Krankenhaus 4.0
Digitalisierung
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet voran. E-Health, mHealth, Telematik oder Smart Health sind nur einige Begriffe, die in diesem Kontext verwendet werden. Um den Begriff Krankenhaus 4.0 verstehen zu können muss der Leitgedanke von Industrie 4.0 verstanden werden. Die erste industrielle Revolution hatte zum Ursprung die Nutzung von Wasser- und Dampfkraft zur mechanischen Produktion. Mit der Inbetriebnahme von Fließbändern wurde im Rahmen der zweiten industriellen Revolution die arbeitsteilige Massenproduktion eingeläutet. Die dritte industrielle Revolution stellte der Einsatz von Elektronik im Zusammenhang mit der Informationstechnik dar, die durch eine zentralisierte und Struktur- und Entscheidungsfindung geprägt war.
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet voran. E-Health, mHealth, Telematik oder Smart Health sind nur einige Begriffe, die in diesem Kontext verwendet werden. Um den Begriff Krankenhaus 4.0 verstehen zu können muss der Leitgedanke von Industrie 4.0 verstanden werden. Die erste industrielle Revolution hatte zum Ursprung die Nutzung von Wasser- und Dampfkraft zur mechanischen Produktion. Mit der Inbetriebnahme von Fließbändern wurde im Rahmen der zweiten industriellen Revolution die arbeitsteilige Massenproduktion eingeläutet. Die dritte industrielle Revolution stellte der Einsatz von Elektronik im Zusammenhang mit der Informationstechnik dar, die durch eine zentralisierte und Struktur- und Entscheidungsfindung geprägt war.
Selbstorganisation und Autonomie
Im Rahmen der vierten industriellen Revolution wird ein weiterer Schritt zur Automatisierung gegangen. Aufgrund der Masse und Komplexität der zu verarbeitenden Informationen sind für die „Industrie 4.0” als Ziel mehr Selbstorganisation und Autonomie zu nennen, in denen einzelne Akteure mittels Cyber-Physikalischer-Systeme (CPS) als autonome Einheiten fungieren können. Autonome Akteure werden selbstbestimmt Informationen aufnehmen, verarbeiten und weitergeben. Auf dieser Basis werden Geschäftsprozesse flexibler und die Individualisierung von Gütern und Waren in der Massenproduktion vorangetrieben. Im Gegensatz zur „Industrie 4.0” stehen im Krankenhaus keine Produktionstechniken, sondern komplexe Diagnose- und Therapieprozesse im Vordergrund, in denen eine direkte Mensch-Mensch-Kommunikationen von zentraler Bedeutung ist. Ärzte und Pflegekräfte können nicht zentral gesteuert werden. Die Mitarbeiter müssen während des gesamten Versorgungsprozesses in der Lage sein, Entscheidungen zeitnah und autonom zu treffen. Ein aus Patienten- und Mitarbeitersicht optimales Ergebnis verlangt aber, dass idealerweise alle Akteure miteinander kommunizieren und die zur Entscheidung notwendigen Informationen aufnehmen, verarbeiten und weitergeben können. Die Datenverfügbarkeit und Transparenz steigt. Hierin liegt der Anknüpfungspunkt zur „Industrie 4.0”. Durch intelligente und dezentrale Assistenz- und Unterstützungssysteme können Informationen gezielter weitergeleitet und verarbeitet werden. Die Mitarbeiter stehen im Zentrum und versorgen den Patienten. Mit zunehmender Spezialisierung und Individualisierung der Medizin werden intelligente Unterstützungssysteme immer wichtiger. Damit bietet das „Krankenhaus 4.0” das Potenzial für effiziente Versorgungsprozesse, die die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses verbessern und gleichzeitig eine individuelle und bedarfsgerechte Versorgung ermöglichen. [1]
Im Rahmen der vierten industriellen Revolution wird ein weiterer Schritt zur Automatisierung gegangen. Aufgrund der Masse und Komplexität der zu verarbeitenden Informationen sind für die „Industrie 4.0” als Ziel mehr Selbstorganisation und Autonomie zu nennen, in denen einzelne Akteure mittels Cyber-Physikalischer-Systeme (CPS) als autonome Einheiten fungieren können. Autonome Akteure werden selbstbestimmt Informationen aufnehmen, verarbeiten und weitergeben. Auf dieser Basis werden Geschäftsprozesse flexibler und die Individualisierung von Gütern und Waren in der Massenproduktion vorangetrieben. Im Gegensatz zur „Industrie 4.0” stehen im Krankenhaus keine Produktionstechniken, sondern komplexe Diagnose- und Therapieprozesse im Vordergrund, in denen eine direkte Mensch-Mensch-Kommunikationen von zentraler Bedeutung ist. Ärzte und Pflegekräfte können nicht zentral gesteuert werden. Die Mitarbeiter müssen während des gesamten Versorgungsprozesses in der Lage sein, Entscheidungen zeitnah und autonom zu treffen. Ein aus Patienten- und Mitarbeitersicht optimales Ergebnis verlangt aber, dass idealerweise alle Akteure miteinander kommunizieren und die zur Entscheidung notwendigen Informationen aufnehmen, verarbeiten und weitergeben können. Die Datenverfügbarkeit und Transparenz steigt. Hierin liegt der Anknüpfungspunkt zur „Industrie 4.0”. Durch intelligente und dezentrale Assistenz- und Unterstützungssysteme können Informationen gezielter weitergeleitet und verarbeitet werden. Die Mitarbeiter stehen im Zentrum und versorgen den Patienten. Mit zunehmender Spezialisierung und Individualisierung der Medizin werden intelligente Unterstützungssysteme immer wichtiger. Damit bietet das „Krankenhaus 4.0” das Potenzial für effiziente Versorgungsprozesse, die die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses verbessern und gleichzeitig eine individuelle und bedarfsgerechte Versorgung ermöglichen. [1]
Spannungsfeld
Krankenhäuser stecken im Status quo noch inmitten der dritten industriellen Revolution, die durch den Versuch eines hohen Standardisierungsgrads sowie zentrale Entscheidungsstrukturen geprägt ist. Krankenhäuser agieren im Spannungsfeld einer zunehmenden Spezialisierung einerseits und der Integration von einzelnen Tätigkeiten in zusammenhängende Prozesse andererseits. Organisatorische Anpassungen finden bei der personenbezogenen Dienstleistung im Krankenhaus im Status quo nahezu ausschließlich quantitativ und kaum qualitativ statt. Technologisch ist die digitale Vernetzung der Akteure in der Gesundheitsversorgung über eine Infrastruktur aus zentralen und dezentralen Elementen grundsätzlich umsetzbar. Im internationalen Vergleich liegen deutsche Krankenhäuser im Bereich der Digitalisierung und E-Health unterhalb des EU-Durchschnitts. Digitale Lösungen zur Einbindung von unterschiedlichen Ressourcen wie Personal, Räumen oder Geräten finden sich genauso wie beispielsweise digitale Helfer in OP-Sälen (OP-Roboter) oder eine elektronische Patientenakte im internationalen Vergleich eher selten. Vorreiter in diesem Bereich sind beispielsweise Dänemark, Luxemburg, Österreich oder Schweden. [2] Dass diese Umstellung in Deutschland mehr Zeit als in anderen Ländern beansprucht, liegt auch daran, dass der Gesundheits- und Sozialmarkt, in dem sich auch Krankenhäuser bewegen, einer der am stärksten regulierten Märkte in Deutschland ist. Unzählige Akteure wie Leistungserbringer, Versicherungen, Ausschüsse und Genehmigungs- und Zulassungsbehörden führen dazu, dass die Folgen konkreter Maßnahmen in dem System immer schwerer prognostizierbar werden. Analogien aus privaten Märkten auch in Bezug auf Innovationen greifen deshalb häufig nicht. Es ist daher notwendig, mehrere Ebenen bei der Diskussion „Krankenhaus 4.0” zu unterscheiden.
Krankenhäuser stecken im Status quo noch inmitten der dritten industriellen Revolution, die durch den Versuch eines hohen Standardisierungsgrads sowie zentrale Entscheidungsstrukturen geprägt ist. Krankenhäuser agieren im Spannungsfeld einer zunehmenden Spezialisierung einerseits und der Integration von einzelnen Tätigkeiten in zusammenhängende Prozesse andererseits. Organisatorische Anpassungen finden bei der personenbezogenen Dienstleistung im Krankenhaus im Status quo nahezu ausschließlich quantitativ und kaum qualitativ statt. Technologisch ist die digitale Vernetzung der Akteure in der Gesundheitsversorgung über eine Infrastruktur aus zentralen und dezentralen Elementen grundsätzlich umsetzbar. Im internationalen Vergleich liegen deutsche Krankenhäuser im Bereich der Digitalisierung und E-Health unterhalb des EU-Durchschnitts. Digitale Lösungen zur Einbindung von unterschiedlichen Ressourcen wie Personal, Räumen oder Geräten finden sich genauso wie beispielsweise digitale Helfer in OP-Sälen (OP-Roboter) oder eine elektronische Patientenakte im internationalen Vergleich eher selten. Vorreiter in diesem Bereich sind beispielsweise Dänemark, Luxemburg, Österreich oder Schweden. [2] Dass diese Umstellung in Deutschland mehr Zeit als in anderen Ländern beansprucht, liegt auch daran, dass der Gesundheits- und Sozialmarkt, in dem sich auch Krankenhäuser bewegen, einer der am stärksten regulierten Märkte in Deutschland ist. Unzählige Akteure wie Leistungserbringer, Versicherungen, Ausschüsse und Genehmigungs- und Zulassungsbehörden führen dazu, dass die Folgen konkreter Maßnahmen in dem System immer schwerer prognostizierbar werden. Analogien aus privaten Märkten auch in Bezug auf Innovationen greifen deshalb häufig nicht. Es ist daher notwendig, mehrere Ebenen bei der Diskussion „Krankenhaus 4.0” zu unterscheiden.